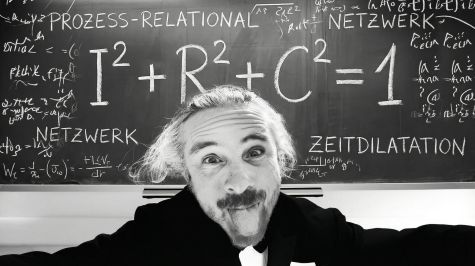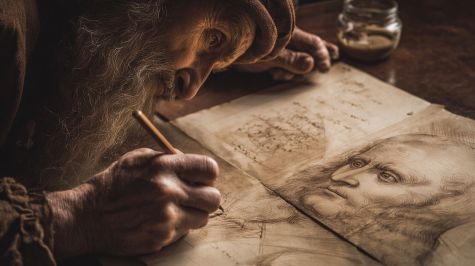Woher kommen Ethik und Moral? Eine radikal neue Antwort
19.11.2025
/
/ PDF
WissenschaftGesellschaftWeltbilder

Der Ursprung unserer Moral
Woher kommt eigentlich unser tiefes Gefühl für "richtig" und "falsch"? Diese Frage beschäftigt die Menschheit seit Jahrtausenden. Ist es eine göttliche Eingebung, ein Produkt unserer Erziehung oder das Ergebnis kühler Vernunft? Die klassischen Antworten aus Religion, Gesellschaftstheorie und Philosophie geben oft Denkanstösse, doch eine letzte, befriedigende Erklärung bleibt meist aus. Es bleibt eine Lücke zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll.
Doch was wäre, wenn die Wurzel unserer Moral viel direkter und fundamentaler in uns selbst verankert ist, als wir bisher dachten? Was, wenn unsere gesamte Ethik direkt aus der grundlegenden Struktur unserer subjektiven Wahrnehmung entsteht? Genau diese revolutionäre These stellt der Forscher Dr. Oliver Marc Wittwer in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Er beschreibt einen Prozess, den er "Ontologische Symmetriebrechung" nennt – die unausweichliche Tatsache, dass wir die Welt nicht objektiv, sondern immer aus einer einzigen, unserer eigenen Perspektive erleben.
Dieser unscheinbare Perspektivwechsel hat tiefgreifende Konsequenzen. Er formt nicht nur unsere Realität, sondern erschafft den gesamten Raum, in dem ethische Urteile erst möglich werden. Dieses Modell ist nicht nur eine philosophische Spielerei; es bietet einen neuen, scharfen Blick auf die drängendsten Probleme unserer Zeit – von politischer Polarisierung und systemischem Rassismus über internationale Konflikte bis hin zur Umweltkrise. Die folgenden vier Thesen, die auf dieser Idee basieren, werden Ihre Sicht darauf, was Moral ist und woher sie kommt, grundlegend verändern.
Die Kernideen in 4 provokanten Thesen
1. Moral kommt nicht von aussen, sondern entsteht in deinem Kopf
Die zentrale Idee ist die "Ontologische Symmetriebrechung". Stellen Sie sich die Welt objektiv vor: eine Ansammlung von Milliarden gleichwertiger Subjekte. In dieser Draufsicht ist niemand wichtiger als der andere – es herrscht perfekte Symmetrie. In dem Moment jedoch, in dem Sie die Welt durch Ihre eigenen Augen wahrnehmen, bricht diese Symmetrie zusammen. Sie werden unausweichlich zum Zentrum Ihrer eigenen erlebten Welt, zum "Ich". Alle anderen Menschen nehmen Sie aus dieser nun asymmetrischen Perspektive als Gegenüber wahr.
Diese Idee ist revolutionär, weil sie eine Brücke über das berühmte "Sein-Sollen-Problem" der Philosophie schlägt. Dieses Problem besagt, dass man aus einer reinen Beschreibung der Welt (dem "Sein") keine moralischen Vorschriften (ein "Sollen") ableiten kann. Die Theorie der Symmetriebrechung zeigt jedoch: Unser moralisches "Sollen" ist keine von aussen auferlegte Regel, sondern eine direkte, unausweichliche Folge der Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen ("Sein"). Unsere Ethik entspringt der fundamentalen Architektur unseres Bewusstseins. Moral ist also kein Regelwerk, das Sie lernen, sondern eine unvermeidliche Konsequenz Ihrer Existenz als Subjekt.
2. Du siehst die Welt durch eine Ich-Du-Es-Brille – und das bestimmt deine Ethik
Aus der gebrochenen Symmetrie ergeben sich drei grundlegende Arten, wie wir andere Wesen wahrnehmen oder auf sie projizieren können:
- Ich (I): Das ist das eigene, erlebende Selbst, der Ausgangspunkt jeder Erfahrung.
- Du (Thou): Ein anderes Wesen, das wir als Gegenüber mit einer eigenen, inneren Subjektivität anerkennen. Wir können mit ihm in eine Beziehung treten.
- Es (It): Ein Wesen oder ein Ding, das wir als reines Objekt ohne eigene Subjektivität wahrnehmen. Es ist ein Mittel zum Zweck, ein Hindernis oder einfach nur eine Sache.
Diese unbewusste Einstufung anderer schafft unseren persönlichen "moralischen Raum". Je nachdem, wie wir andere Wesen kategorisieren, ergeben sich daraus völlig unterschiedliche ethische Grundhaltungen, wie Wittwers Typologie zeigt:
- Solipsistische Haltung (Ich-Es): Nur das eigene "Ich" zählt. Alle anderen sind Objekte ("Es"), die dem eigenen Nutzen dienen. Moralische Grenzen existieren nur zum Selbstschutz.
- Unterwürfige Haltung (i-I): Das eigene Selbst wird als klein und unbedeutend wahrgenommen (kleines "i"), während andere idealisiert und als übermächtig empfunden werden ("I"). Der eigene Wert wird aus der Aufopferung für andere bezogen.
- Selektive Haltung (Ich-Du-Es): Hier findet die klassische In-Group/Out-Group-Logik statt. Die eigene Gruppe wird als vollwertige "Dus" anerkannt, während Aussenstehende zu Objekten ("Es") degradiert werden. Dies ist die Wahrnehmungsgrundlage für Nationalismus, Rassismus und Fanatismus.
- Konventionelle Haltung (Ich-Du): Andere werden als abstrakte Partner anerkannt, deren Rechte durch Regeln und Gesetze geschützt sind. Die Beziehung ist aber eher formal als von tiefem Mitgefühl geprägt.
- Empathische Haltung (Ich-Ich): Andere werden nicht nur als Gegenüber, sondern als vollwertige Subjekte mit einer Innenwelt anerkannt, die der eigenen gleicht. Dies ist die Basis für echtes Mitgefühl.
- Universelle Haltung (Ich-{Ich}): Die höchste Stufe der ethischen Entwicklung. Hier wird die Fähigkeit zur Empathie über die menschliche Spezies hinaus auf alle Wesen oder sogar das gesamte Ökosystem ausgeweitet.
Ihre alltägliche moralische Realität ist also keine bewusste Wahl, sondern ein unbewusster Sortierprozess. Die entscheidende Frage lautet: Wer hat Ihnen die Sortierkriterien gegeben?
3. Die Wurzel des Bösen? Wenn Menschen zu Objekten werden
Wie können Menschen zu grausamen Taten fähig sein? Das Modell liefert eine beunruhigend einfache Antwort: durch einen Prozess der "ethischen Umkodierung". Dieser Prozess ist keine Rechtfertigung nach der Tat, sondern eine Wahrnehmung vor der Tat. Indem eine Person oder eine ganze Gruppe mental zu einem "Es" – einem Objekt – degradiert wird, werden Handlungen, die gegenüber einem "Du" oder einem "Ich" undenkbar wären, plötzlich "ethisch zulässig oder sogar geboten". Man kann einem Stuhl nichts antun, was moralisch verwerflich wäre.
Die Theorie bietet hierfür eine noch tiefere Analyseebene an: die Unterscheidung zwischen dominanten (Grossbuchstaben: I, E) und unterdrückten (Kleinbuchstaben: i, e) Projektionen. In Systemen wie dem Kolonialismus oder Rassismus projiziert die Tätergruppe ein dominantes Selbstbild (I), während sie der Opfergruppe einen unterdrückten Objektstatus (e) aufzwingt. Gleichzeitig zwingt diese Dynamik die Opfergruppe oft in ein unterdrücktes Selbstbild (i). Diese "Herr-Knecht"-Dynamik stabilisiert Machtstrukturen auf einer tiefen psychologischen Ebene, indem sie die Wahrnehmung der Realität selbst verzerrt.
Wittwer fasst den Mechanismus der nachträglichen Rechtfertigung, der auf dieser Wahrnehmungsverzerrung aufbaut, prägnant zusammen:
Ethische "Rechtfertigungen" funktionieren oft genau so, wie ihr Name andeutet: als Versuch, etwas zu einem Recht zu machen, das es im Grunde nicht ist.
Die Ursache des Bösen ist demnach kein metaphysisches Rätsel, sondern eine Störung der Wahrnehmung – ein Versagen, das "Ich" im Anderen zu sehen.
4. Ethische Reife ist trainierbar – indem du deine Wahrnehmung schulst
Wenn Moral aus Wahrnehmung entsteht, dann ist ethische Entwicklung nicht primär das Lernen von Regeln, sondern die Entwicklung unserer "projektiven Fähigkeit". Es geht darum, die Fähigkeit zu kultivieren, immer mehr Wesen nicht nur als abstrakte "Dus" oder funktionale "Es", sondern als vollwertige Subjekte ("Ichs") mit einer eigenen, reichen Innenwelt wahrzunehmen.
Der Schlüssel dazu liegt in der "reflektiven Aufmerksamkeit". Indem wir bewusst darüber nachdenken, wie wir die Welt sehen – welche unbewussten Vorurteile und Kategorisierungen unsere Wahrnehmung filtern –, können wir diese Muster erkennen und verändern. Wir können unsere Empathie und damit unsere ethische Haltung aktiv schulen, indem wir uns bewusst fragen, warum wir jemanden als "Es" und nicht als "Ich" wahrnehmen.
Dies ist vielleicht die hoffnungsvollste Botschaft dieses Modells: Ethik ist keine starre Eigenschaft, die man hat oder nicht hat. Sie ist eine Fähigkeit, die durch Selbstreflexion wachsen und sich ein Leben lang entwickeln kann. Ihre Ethik ist kein festes Urteil über Ihren Charakter, sondern eine lebendige Kompetenz, die Sie durch bewusste Selbstreflexion kultivieren können.
Was siehst du, wenn du andere ansiehst?
Die zentrale Botschaft ist ebenso einfach wie tiefgreifend: Unsere Ethik ist kein externer Kodex, dem wir folgen, sondern ein direkter Spiegel unserer innersten Wahrnehmung der Welt. Die Art und Weise, wie wir andere sehen, bestimmt die Art und Weise, wie wir sie behandeln. Die grossen Konflikte unserer Zeit sind somit auch Krisen der Wahrnehmung – ein Versagen, das gemeinsame "Ich" in den Mitgliedern der "anderen" politischen Partei, der "fremden" Kultur oder sogar in der Natur selbst zu erkennen.
Das wirft eine letzte, entscheidende Frage auf, die Sie mit in Ihren Alltag nehmen können: In welchen Situationen deines Lebens neigst du dazu, andere Menschen eher als "Es" zu behandeln – als Hindernis im Verkehr, als anonymes Profil online, als Dienstleister hinter einer Theke? Und was würde sich ändern, wenn du bewusst versuchst, das "Ich" in ihnen zu erkennen?
Text basierend auf dem wissenschaftlichen Paper "Ethik-Emergenz" von Dr. Oliver Marc Wittwer
WissenschaftGesellschaftWeltbilder

Der Ursprung unserer Moral
Woher kommt eigentlich unser tiefes Gefühl für "richtig" und "falsch"? Diese Frage beschäftigt die Menschheit seit Jahrtausenden. Ist es eine göttliche Eingebung, ein Produkt unserer Erziehung oder das Ergebnis kühler Vernunft? Die klassischen Antworten aus Religion, Gesellschaftstheorie und Philosophie geben oft Denkanstösse, doch eine letzte, befriedigende Erklärung bleibt meist aus. Es bleibt eine Lücke zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll.
Doch was wäre, wenn die Wurzel unserer Moral viel direkter und fundamentaler in uns selbst verankert ist, als wir bisher dachten? Was, wenn unsere gesamte Ethik direkt aus der grundlegenden Struktur unserer subjektiven Wahrnehmung entsteht? Genau diese revolutionäre These stellt der Forscher Dr. Oliver Marc Wittwer in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Er beschreibt einen Prozess, den er "Ontologische Symmetriebrechung" nennt – die unausweichliche Tatsache, dass wir die Welt nicht objektiv, sondern immer aus einer einzigen, unserer eigenen Perspektive erleben.
Dieser unscheinbare Perspektivwechsel hat tiefgreifende Konsequenzen. Er formt nicht nur unsere Realität, sondern erschafft den gesamten Raum, in dem ethische Urteile erst möglich werden. Dieses Modell ist nicht nur eine philosophische Spielerei; es bietet einen neuen, scharfen Blick auf die drängendsten Probleme unserer Zeit – von politischer Polarisierung und systemischem Rassismus über internationale Konflikte bis hin zur Umweltkrise. Die folgenden vier Thesen, die auf dieser Idee basieren, werden Ihre Sicht darauf, was Moral ist und woher sie kommt, grundlegend verändern.
Die Kernideen in 4 provokanten Thesen
1. Moral kommt nicht von aussen, sondern entsteht in deinem Kopf
Die zentrale Idee ist die "Ontologische Symmetriebrechung". Stellen Sie sich die Welt objektiv vor: eine Ansammlung von Milliarden gleichwertiger Subjekte. In dieser Draufsicht ist niemand wichtiger als der andere – es herrscht perfekte Symmetrie. In dem Moment jedoch, in dem Sie die Welt durch Ihre eigenen Augen wahrnehmen, bricht diese Symmetrie zusammen. Sie werden unausweichlich zum Zentrum Ihrer eigenen erlebten Welt, zum "Ich". Alle anderen Menschen nehmen Sie aus dieser nun asymmetrischen Perspektive als Gegenüber wahr.
Diese Idee ist revolutionär, weil sie eine Brücke über das berühmte "Sein-Sollen-Problem" der Philosophie schlägt. Dieses Problem besagt, dass man aus einer reinen Beschreibung der Welt (dem "Sein") keine moralischen Vorschriften (ein "Sollen") ableiten kann. Die Theorie der Symmetriebrechung zeigt jedoch: Unser moralisches "Sollen" ist keine von aussen auferlegte Regel, sondern eine direkte, unausweichliche Folge der Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen ("Sein"). Unsere Ethik entspringt der fundamentalen Architektur unseres Bewusstseins. Moral ist also kein Regelwerk, das Sie lernen, sondern eine unvermeidliche Konsequenz Ihrer Existenz als Subjekt.
2. Du siehst die Welt durch eine Ich-Du-Es-Brille – und das bestimmt deine Ethik
Aus der gebrochenen Symmetrie ergeben sich drei grundlegende Arten, wie wir andere Wesen wahrnehmen oder auf sie projizieren können:
- Ich (I): Das ist das eigene, erlebende Selbst, der Ausgangspunkt jeder Erfahrung.
- Du (Thou): Ein anderes Wesen, das wir als Gegenüber mit einer eigenen, inneren Subjektivität anerkennen. Wir können mit ihm in eine Beziehung treten.
- Es (It): Ein Wesen oder ein Ding, das wir als reines Objekt ohne eigene Subjektivität wahrnehmen. Es ist ein Mittel zum Zweck, ein Hindernis oder einfach nur eine Sache.
Diese unbewusste Einstufung anderer schafft unseren persönlichen "moralischen Raum". Je nachdem, wie wir andere Wesen kategorisieren, ergeben sich daraus völlig unterschiedliche ethische Grundhaltungen, wie Wittwers Typologie zeigt:
- Solipsistische Haltung (Ich-Es): Nur das eigene "Ich" zählt. Alle anderen sind Objekte ("Es"), die dem eigenen Nutzen dienen. Moralische Grenzen existieren nur zum Selbstschutz.
- Unterwürfige Haltung (i-I): Das eigene Selbst wird als klein und unbedeutend wahrgenommen (kleines "i"), während andere idealisiert und als übermächtig empfunden werden ("I"). Der eigene Wert wird aus der Aufopferung für andere bezogen.
- Selektive Haltung (Ich-Du-Es): Hier findet die klassische In-Group/Out-Group-Logik statt. Die eigene Gruppe wird als vollwertige "Dus" anerkannt, während Aussenstehende zu Objekten ("Es") degradiert werden. Dies ist die Wahrnehmungsgrundlage für Nationalismus, Rassismus und Fanatismus.
- Konventionelle Haltung (Ich-Du): Andere werden als abstrakte Partner anerkannt, deren Rechte durch Regeln und Gesetze geschützt sind. Die Beziehung ist aber eher formal als von tiefem Mitgefühl geprägt.
- Empathische Haltung (Ich-Ich): Andere werden nicht nur als Gegenüber, sondern als vollwertige Subjekte mit einer Innenwelt anerkannt, die der eigenen gleicht. Dies ist die Basis für echtes Mitgefühl.
- Universelle Haltung (Ich-{Ich}): Die höchste Stufe der ethischen Entwicklung. Hier wird die Fähigkeit zur Empathie über die menschliche Spezies hinaus auf alle Wesen oder sogar das gesamte Ökosystem ausgeweitet.
Ihre alltägliche moralische Realität ist also keine bewusste Wahl, sondern ein unbewusster Sortierprozess. Die entscheidende Frage lautet: Wer hat Ihnen die Sortierkriterien gegeben?
3. Die Wurzel des Bösen? Wenn Menschen zu Objekten werden
Wie können Menschen zu grausamen Taten fähig sein? Das Modell liefert eine beunruhigend einfache Antwort: durch einen Prozess der "ethischen Umkodierung". Dieser Prozess ist keine Rechtfertigung nach der Tat, sondern eine Wahrnehmung vor der Tat. Indem eine Person oder eine ganze Gruppe mental zu einem "Es" – einem Objekt – degradiert wird, werden Handlungen, die gegenüber einem "Du" oder einem "Ich" undenkbar wären, plötzlich "ethisch zulässig oder sogar geboten". Man kann einem Stuhl nichts antun, was moralisch verwerflich wäre.
Die Theorie bietet hierfür eine noch tiefere Analyseebene an: die Unterscheidung zwischen dominanten (Grossbuchstaben: I, E) und unterdrückten (Kleinbuchstaben: i, e) Projektionen. In Systemen wie dem Kolonialismus oder Rassismus projiziert die Tätergruppe ein dominantes Selbstbild (I), während sie der Opfergruppe einen unterdrückten Objektstatus (e) aufzwingt. Gleichzeitig zwingt diese Dynamik die Opfergruppe oft in ein unterdrücktes Selbstbild (i). Diese "Herr-Knecht"-Dynamik stabilisiert Machtstrukturen auf einer tiefen psychologischen Ebene, indem sie die Wahrnehmung der Realität selbst verzerrt.
Wittwer fasst den Mechanismus der nachträglichen Rechtfertigung, der auf dieser Wahrnehmungsverzerrung aufbaut, prägnant zusammen:
Ethische "Rechtfertigungen" funktionieren oft genau so, wie ihr Name andeutet: als Versuch, etwas zu einem Recht zu machen, das es im Grunde nicht ist.
Die Ursache des Bösen ist demnach kein metaphysisches Rätsel, sondern eine Störung der Wahrnehmung – ein Versagen, das "Ich" im Anderen zu sehen.
4. Ethische Reife ist trainierbar – indem du deine Wahrnehmung schulst
Wenn Moral aus Wahrnehmung entsteht, dann ist ethische Entwicklung nicht primär das Lernen von Regeln, sondern die Entwicklung unserer "projektiven Fähigkeit". Es geht darum, die Fähigkeit zu kultivieren, immer mehr Wesen nicht nur als abstrakte "Dus" oder funktionale "Es", sondern als vollwertige Subjekte ("Ichs") mit einer eigenen, reichen Innenwelt wahrzunehmen.
Der Schlüssel dazu liegt in der "reflektiven Aufmerksamkeit". Indem wir bewusst darüber nachdenken, wie wir die Welt sehen – welche unbewussten Vorurteile und Kategorisierungen unsere Wahrnehmung filtern –, können wir diese Muster erkennen und verändern. Wir können unsere Empathie und damit unsere ethische Haltung aktiv schulen, indem wir uns bewusst fragen, warum wir jemanden als "Es" und nicht als "Ich" wahrnehmen.
Dies ist vielleicht die hoffnungsvollste Botschaft dieses Modells: Ethik ist keine starre Eigenschaft, die man hat oder nicht hat. Sie ist eine Fähigkeit, die durch Selbstreflexion wachsen und sich ein Leben lang entwickeln kann. Ihre Ethik ist kein festes Urteil über Ihren Charakter, sondern eine lebendige Kompetenz, die Sie durch bewusste Selbstreflexion kultivieren können.
Was siehst du, wenn du andere ansiehst?
Die zentrale Botschaft ist ebenso einfach wie tiefgreifend: Unsere Ethik ist kein externer Kodex, dem wir folgen, sondern ein direkter Spiegel unserer innersten Wahrnehmung der Welt. Die Art und Weise, wie wir andere sehen, bestimmt die Art und Weise, wie wir sie behandeln. Die grossen Konflikte unserer Zeit sind somit auch Krisen der Wahrnehmung – ein Versagen, das gemeinsame "Ich" in den Mitgliedern der "anderen" politischen Partei, der "fremden" Kultur oder sogar in der Natur selbst zu erkennen.
Das wirft eine letzte, entscheidende Frage auf, die Sie mit in Ihren Alltag nehmen können: In welchen Situationen deines Lebens neigst du dazu, andere Menschen eher als "Es" zu behandeln – als Hindernis im Verkehr, als anonymes Profil online, als Dienstleister hinter einer Theke? Und was würde sich ändern, wenn du bewusst versuchst, das "Ich" in ihnen zu erkennen?
Text basierend auf dem wissenschaftlichen Paper "Ethik-Emergenz" von Dr. Oliver Marc Wittwer